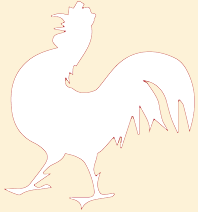Bäuerliches Handwerk
Eine lange Tradition
Wusstest Du, dass das bäuerliche Handwerk seine Blütezeit zwischen 1800 und 1900 erlebte? Und dass neben den spezialisierten Handwerkern auch Kleinbauern und Vollerwerbsbauern handwerklich tätig waren? Mit „Roter Hahn“ kannst Du in den bäuerlichen Alltag von damals eintauchen.
Wusstest Du, dass das bäuerliche Handwerk seine Blütezeit zwischen 1800 und 1900 erlebte? Und dass neben den spezialisierten Handwerkern auch Kleinbauern und Vollerwerbsbauern handwerklich tätig waren? Mit „Roter Hahn“ kannst Du in den bäuerlichen Alltag von damals eintauchen.
Die Kleinbauern, die nur wenig Besitz hatten und meist ein Handwerk als Zuverdienst ausübten, nannte man „Kleinhäusler“. Entweder sie richteten sich eine kleine Werkstatt bei sich ein oder aber sie gingen „auf die Stör“, also auf Wanderschaft. Am Land war es Brauch, sich die Handwerker ins Haus zu holen anstatt sie aufzusuchen. Deshalb zogen beispielsweise Schneider, Schuster und Weber von Hof zu Hof und fertigten Schuhe und Gewand für die ganze Familie an. Die Entlohnung bestand aus freier Kost und Logis. Im Spätherbst kam dazu noch die „Besserung“, eine Naturalabgabe z.B. in Form von Getreide, Mohn oder Brot. Die Bäuerin kochte häufig Sonntagsgerichte, wenn die „Störhandwerker“ im Haus waren, um sich anschließend nichts nachsagen zu müssen. Die Handwerker „auf der Stör“ kamen weit herum und wussten deshalb viele Neuigkeiten zu erzählen. Dies war eine willkommene Abwechslung im bäuerlichen Alltag.
Handwerk in den Wintermonaten
Die Winterzeit gehört auf den Bauernhöfen in Südtirol zur ruhigeren Zeit im Jahr. Dann betätigten sich auch die Vollerwerbsbauern für den Eigengebrauch handwerklich. Diese Bauern mit acht Stück Vieh und mehr im Stall sowie Ackerland hatten es unters Jahr nicht nötig einen Zuerwerb auszuüben. Auf jedem Bauernhof gab es fürs Werkeln eine Werkstatt, die „Machkammer“, die für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten des bäuerlichen Handwerksgeräts genutzt wurde. Darüber hinaus fertigten die Bauern unterschiedliche Gegenstände für den täglichen Gebrauch an: Es wurden Körbe geflochten, Rechen gemacht oder an der Drehbank Teller, Schalen und Wetzkümpfe aus Zirbenholz gedrechselt. Während die Männer meist mit Holz arbeiteten, widmeten sich die Frauen vor allem der Wollverarbeitung.
Vielfach wurden die handwerklichen Fertigkeiten von Generation zu Generation weitergegeben, was auch heute noch sehr oft geschieht. Von den Großeltern zu den Eltern und anschließend zu den Kindern und Enkelkindern wird das wertvolle Können gewissenhaft und geduldig weitergegeben, sodass es nicht in Vergessenheit gerät.
Handwerke zum Kennenlernen
Kennst Du dieses Handwerk?
Bauernhof-Suche
Gelebte Tradition heute
Die Handwerks-Bauernhöfe der Marke „Roter Hahn“ bringen Dich ganz nah an die gelebten Traditionen von damals heran.
- Holzschnitzarbeiten
- Drechselarbeiten
- Holzschnitzarbeiten
- Flechtarbeiten
- Werke aus Altholz
- Werke aus Wolle